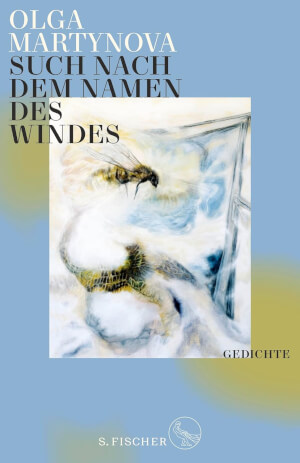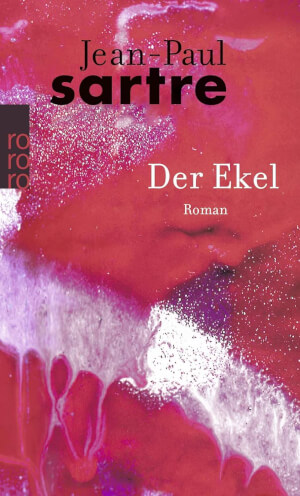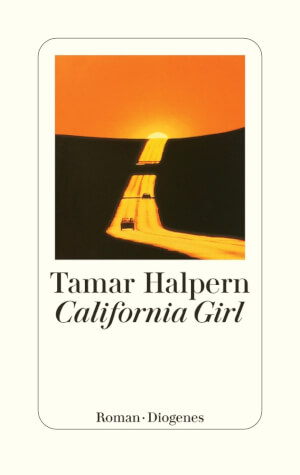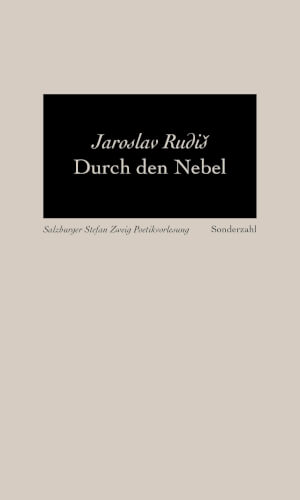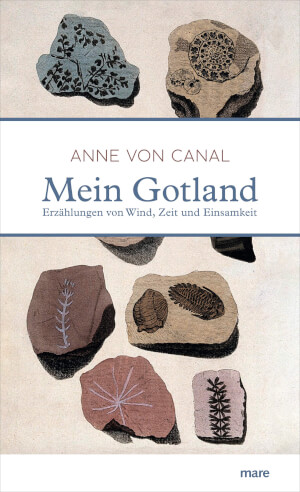Judith Schalansky: Verzeichnis einiger Verluste
Grenzen, Ausblicke und Ansichten
Mit dem "Atlas der abgelegenen Inseln" (2009) und dem Roman "Der Hals der Giraffe" (2011) wurde die 1980 in Greifswald geborene Schriftstellerin Judith Schalansky einer größeren Öffentlichkeit bekannt. Besondere, ja eigenwillige Bücher hat die auch als Herausgeberin der "Naturkunden" tätige Autorin bereits publiziert. Ihre Texte bewegen sich jenseits der einschlägigen Kategorien und Konventionen der Literatur. So erkundet Schalansky Neuland, markant, mit sorgfältigem Gespür für Besonderheiten, für zuweilen grotesk Anmutendes und höchst Eigenes, das eingebettet ist in die Welt und Umwelt von Menschen und Tieren.
Konventionell mutet eine gleichwohl naheliegende Frage an: Handelt es sich bei den 12 Erzählungen dieses Bandes wirklich um Erzählungen? Nicht im klassischen Sinne, Judith Schalansky stellt Schriftstücke vor und verknüpft philosophische Einsichten mit differenziert konturierten Beobachtungen. Literarische Impressionen wechseln mit Wegbeschreibungen von Traumlandschaften und Fantasien. Die Autorin kennt und ignoriert die Ordnungsprinzipien der Literatur ebenso wie die etablierten gesellschaftlichen Vorstellungen von Wissenschaft, Liebe und Moral. Sie entfaltet einen literarischen Kosmos, freisinnig wie freigeistig. Schalansky ist als Schriftstellerin eine selbstbewusste Philosophin der Aufklärung, eine im besten Sinne eigenwillige Naturforscherin. Zu ihrem Spezialgebiet gehören auch die verborgenen Winkel im weiten Land der Seele. Sie denkt über die Vergänglichkeit nach, wie viele andere auch, aber ganz anders als fast alle anderen. So benennt die Autorin die "Totenklage" als die "Quelle jeder Kultur". Die "klaffende Leerstelle" und die "plötzliche Stille" wirken nach. Kulturelle Formen sprossen hervor, aber eine "Eigenart des Menschen" ist das mitnichten. Judith Schalansky berichtet von grauen Riesen: "So versammeln sich Elefanten beispielsweise um ein sterbendes Herdenmitglied, berühren es stundenlang mit dem Rüssel, trompeten dabei aufgebracht und versuchen oft noch, den leblosen Körper wieder aufzurichten, ehe sie den Leichnam schließlich mit Erde und Zweigen bedecken. Auch werden jene Sterbe-Orte von ihnen noch Jahre später regelmäßig aufgesucht, wozu es zweifellos eines guten Gedächtnisses, womöglich sogar gewisser Jenseitsvorstellungen bedarf, die wir uns nicht weniger phantastisch als die unsrigen und ebenso unverifizierbar vorstellen können." Es sei dahingestellt, ob wir uns überhaupt einen Elefantenhimmel ausmalen müssen. Die Dickhäuter verhalten sich nicht menschlich. Warum sollten sie auch? Aber die Verbindungen zwischen Mensch und Tier reichen weiter, als sich auch die klugen Denker der Aufklärung im 18. Jahrhundert hätten vorstellen können und wollen. Die Neuzeit, der Glaube an die Macht der aufgeklärten Vernunft, ist längst Geschichte geworden. Wahrnehmungsverschiebungen deutet Judith Schalansky an. Der herrschende Anthropozentrismus erscheint korrekturbedürftig. Elefanten verfügen nicht nur über vielfältige Formen der Kommunikation – über ein, wie die niederländische Philosophin Eva Meijer sagt, artspezifisches Sprachvermögen –, sie besitzen auch ein Bewusstsein für Individualität. Töricht wäre es, die Fähigkeit zu Sensibilität, Güte und Mitgefühl auf Menschen zu begrenzen.
Judith Schalansky betreibt eine abweichende Form der Geschichten- und Geschichtsschreibung. Sie folgt den Spuren dessen, was sie als "unwiederbringlich Verlorenes" bezeichnet. Zugleich weiß sie, dass "am Leben zu sein bedeutet, Verluste zu erfahren". Sie denkt über den "Abwehrzauber des süßbittren Vorausleidens" nach: Wir antizipieren denkend, was verschwinden wird. Die groß angelegten Untergangsphantasien der Europäer bezeichnet sie als eine "selbstherrliche Weltsicht", mit der auch die "Ermordung nichteuropäischer Völker" legitimiert worden sei. Die kulturell adaptierte "Formel der Evolutionstheorie, nach der nur der Stärkere überlebt" beurteilt die Autorin als "Rechtfertigung begangener Verbrechen".
Eine gewisse Sympathie bringt Schalansky dem Mythos entgegen, der das "feiner gesponnene Garn eines Traumes" sei. Auf dem Atoll Tuanaki, nach einem Seebeben verschwunden, habe ein alter Insulaner gesagt oder sagen können, dass niemand auf der Insel zu töten wisse. Bekannt sei aber, wie getanzt werde: "Denn der Mythos ist die höchste aller Wirklichkeiten und, so dachte ich für einen Moment, die Bibliothek der wahre Schauplatz des Weltgeschehens." Verwebt mit der Geschichte sind realistische Fantasien. Die Entzauberung der so oft nostalgisch verklärten Römerzeit findet statt, am Beispiel des Kaisers Claudius. Der stotternde Herrscher, als "Missgeburt" von der eigenen Mutter verachtet, beobachtet die Zirkusspiele: "Was verhalf ihm denn zur Macht? Der bloße Umstand, dass er am Leben war, der Einzige der Kaiserfamilie, der Letzte seines Geschlechts. Niemand hatte ihn jemals ernst genommen, ihn, die Missgeburt." Nicht von Poeten wie Horaz und Ovid ist die Rede, nicht von Philosophen wie Seneca. Tiere werden zu Tode gehetzt, danach kämpfen Gladiatoren. Das dekadente Rom feiert, jubelt, singt, johlt und geifert: "In der Luft hängt der Geruch von Verwesung." Judith Schalansky beschreibt eine Welt ohne Mitleid. Doch verhält es sich in der Moderne anders, zum Beispiel in "Manhattan"? Schon die Sprache offenbart Abgründe: "Für die wahre Liebe sterben oder so ein kotzerbärmlicher Quatsch." Über Marilyn Monroe folgen kleine Beobachtungen: "Das war ja die kleine Monroe, Lider auf Halbmast, knallblond, die Schultern frei – halb Luder, halb Luxuspuppe, aber nicht ohne Stil. Dabei hatte sie wirklich was auf dem Kasten." Die Beschreibungen werden den Farben der herzlosen Umwelt entsprechend geformt.
Mit großer Nüchternheit denkt die Autorin über "Sapphos Liebeslieder" nach. Der Eros sei "ein Gott", aber auch eine "Krankheit mit unklaren Symptomen". Zugleich schreibt sie: "Wir wissen nichts. Jedenfalls nicht viel." Von der hellenischen Antike führt ein Weg ins 19. Jahrhundert. In Schottland seien 1819 zwei Lehrerinnen freigesprochen worden, weil die Antwort auf die Frage, "was Frauen miteinander treiben", einfach "so ungesagt wie unsagbar" geblieben sei. Das "Vergehen", so der Richter, sei gar nicht möglich gewesen: "Wo kein Instrument, da auch kein Akt, wo keine Waffe, da auch kein Verbrechen." Ein "blinder Fleck" bleibe: "Wir wissen, dass Worte wie Zeichen ihre Bedeutung verändern. Lange bezeichneten die drei aufeinanderfolgenden Punkte auf der unteren Schreiblinie das Verlorene und Unbekannte, irgendwann auch das Ungesagte und Unsagbare, nicht mehr nur das Weg- und Aus-, sondern auch das Offengelassene. So wurden die drei Punkte zu einem Zeichen, das dazu auffordert, Angedeutetes zu Ende zu denken, sich Fehlendes vorzustellen, ein Stellvertreter für das Unaussprechliche und Totgeschwiegene, für das Anstößige und Obszöne, für das Inkriminierte und Spekulative, für eine besondere Spielart des Ausgelassenen: das Eigentliche." Aber auch hier zeigt sich eine sehr menschliche Sicht: Warum soll ausgerechnet das anscheinend Unsagbare oder Verschwiegene das "Eigentliche" darstellen? Immer wieder werden sexuelle Themen bedacht, als ob das Spezifische aller Kreaturen in der Geschlechtlichkeit liegen würde. Warum eigentlich? Verkürzt der Mensch sich nicht selbst, wenn er derart reduziert von sich denkt? Welche Leerstellen mag die beharrliche Aufmerksamkeit, die auf das körperliche Begehren und bestimmte Formen der Sexualität gerichtet ist, verdecken? In der "Enzyklopädie im Walde" heißt es: "Was ist schon grausam? Einen Mann durch Küsse, durch allerlei Enthüllungen und Offenbarungen, Berührungen, Blicke, Lektüren, Gerede zur Leidenschaft zu reizen, ihn dadurch rückhaltlos zu entflammen, es aber dann, entgegen all den gemachten Versprechungen, nicht zum Äußersten kommen zu lassen – offenbar allein, um ihn also umso schmerzlicher leiden zu lassen und sich offenbar am Anblick des Schmerzes zu weiden." Werden Menschen also zu bloßen Spielfiguren? "Eine Frau ist, was den mechanischen Vorgang anbelangt, zu ununterbrochenem Verkehr in der Lage." Die naturwissenschaftliche Beobachtung des einsamen Waldgängers Armand Schulthess, der eine Sammlung von Sexualkunden erstellt hatte, legt die Autorin dar, ohne die Besonderheit zu analysieren oder darüber zu urteilen. Dieser hatte sich 1951 ins Valle Onsernone zurückgezogen. 1972 stürzte er in seinem Garten und starb dort an Erschöpfungen und Erfrierungen. Gelingt aber jemandem wie Schulthess die skurrile, ja absurde Konzentration auf das vermeintliche oder tatsächliche Wesen der Dinge oder der Person? Oder entsteht nur eine zufällige Zuschreibung? Könnte dies, im literarischen Bereich, wie bei der Kunst der Auslassung, vielleicht nur eine zeitbedingte Form des Schreibens sein? Fragen wie diese bleiben offen. Judith Schalansky beherrscht die Gabe, knapp und präzise zu formulieren, so in "Das Schloss von Behr": "Die Kirche lag mitten im Ort, aber alle gingen vorbei." Mit diesem Satz ist alles gesagt. Trotzdem setzt sie den Gedanken wenig später fort: "Wir wohnten direkt neben der Kirche. Aber sie bedeutete nichts." Ihre besondere Leidenschaft für die Naturbeobachtung wird spürbar, wenn sie das Verhalten von Vögeln beschreibt: "Schrill rufen die tief über dem gewellten Wasser hin und her schießenden Mauersegler. Drei Rauchschwalben sitzen auf der Reling eines Schoners. Ihre fuchsroten Kehlen leuchten in der Abendsonne." Die Autorin vermag menschliche Wahrnehmungen und Beobachtungen zu analysieren und kunstvoll zu reflektieren. Das Handwerk des Schreibens beherrscht Judith Schalansky, vielseitig begabt, ganz gewiss. Ihre künstlerische Souveränität im Umgang mit Sprache bezeugt dieser ästhetisch ansprechend gestaltete Band auf beeindruckende Weise.