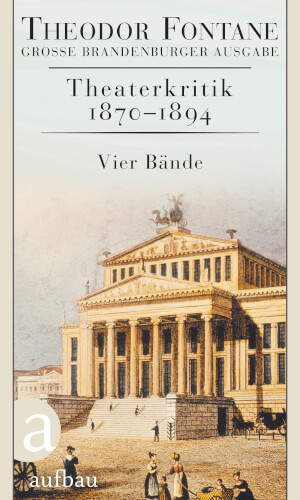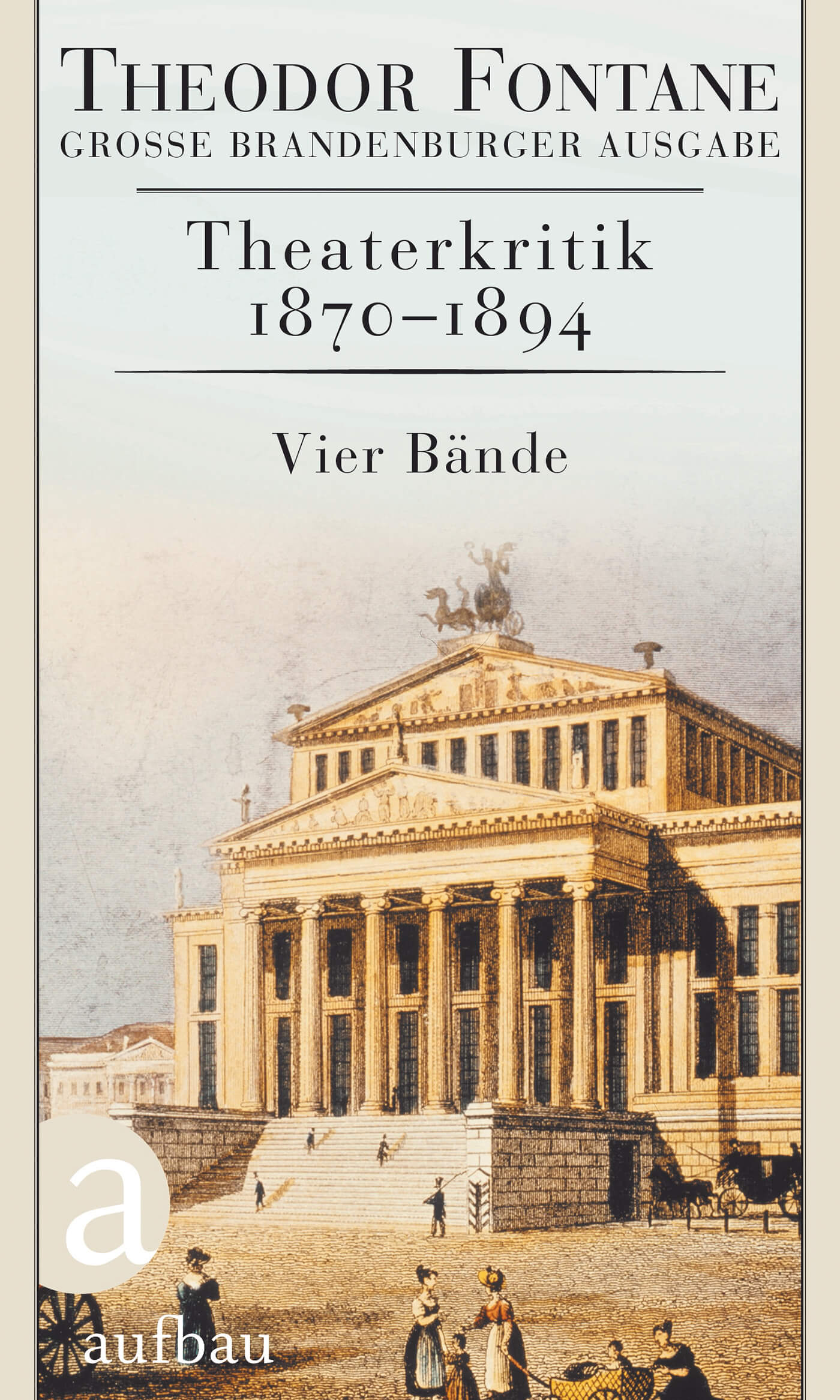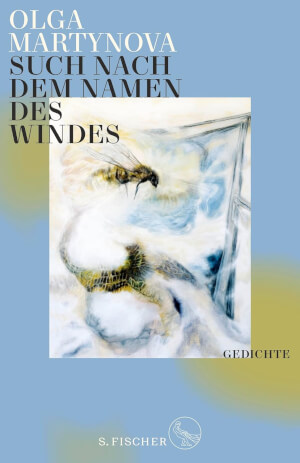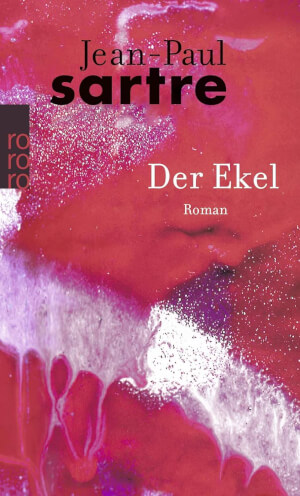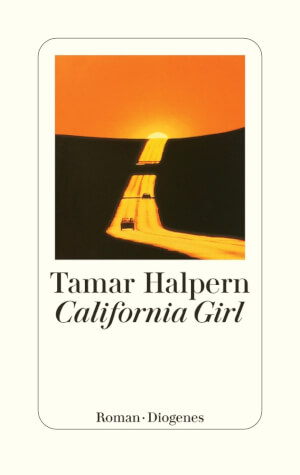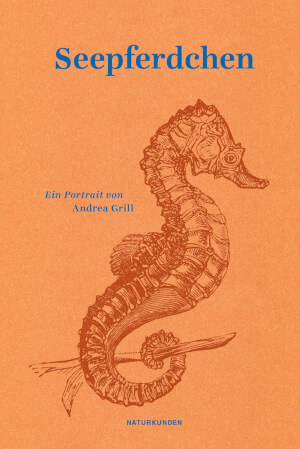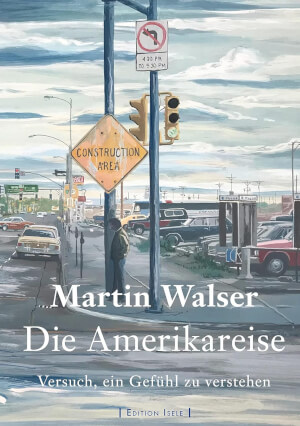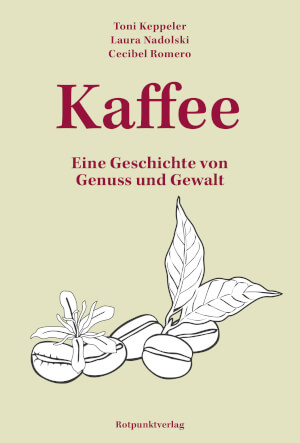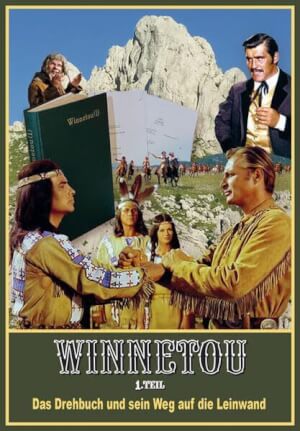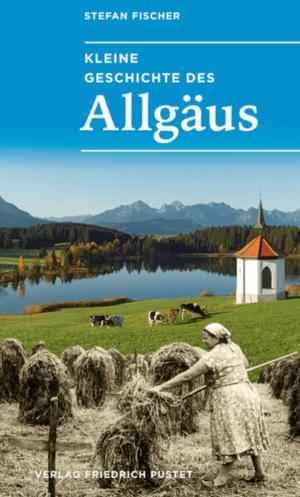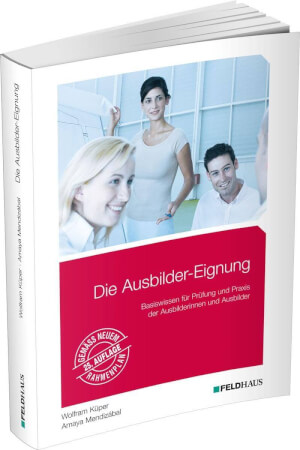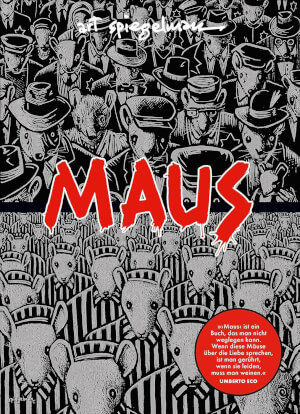Fast wie im richtigen Leben? – Theodor Fontane porträtiert die Berliner Theaterkunst
Vom Parkettplatz 23 des Königlichen Schauspielhauses aus verfolgt Theodor Fontane von 1870 bis 1894 Inszenierungen am Berliner Gendarmenmarkt, mit Leidenschaft, stets teilnahmsvoll, mit Liebe und Mitgefühl, nie distanziert, pathetisch, übellaunig oder feierlich. 1872 bemerkt er: "Man räsonnirt immer vom Verfall des Theaters; wir selber wissen uns von dieser Schuld nicht frei. Vielleicht hat die Gegenwart immer diesen schweren Stand." Welcher Liebhaber der Bühnenkunst wollte knapp 150 Jahre später bei diesen Worten nicht verständig nicken, an eigene Grübeleien denkend? War früher nicht alles anders, und wenn nicht alles, so doch vieles besser? Zumindest erhabener präsentiert, in gefälligen Inszenierungen? Fontane kennt die Vorurteile der Zuschauer gut, nämlich von sich selbst. So plaudert der Theaterkritiker über eine bunte Welt, mitunter scharfzüngig, aber niemals gehässig, mokant oder prätentiös. Nichts ist dem Bürger Theodor Fontane mehr zuwider als der bürgerliche, biedere Tonfall.
Wir, damals wie heute, gehen ins Theater. Was sehen wir? Immer dasselbe, aber hoffentlich nicht immer auf dieselbe Art. Öfter als Goethe wird Schiller inszeniert. Fontane weiß, dass es zuweilen schwer erträglich ist, immerzu dessen Moralpredigten zu vernehmen, und er weiß, dass es unverzeihlich wäre, auf ihn deswegen verzichten zu wollen. Oft dargeboten wird also Schiller, als Schulstoff, in Festreden wird er beschworen – bis heute –, ja, "längst Allgemeingut" sei der Dramatiker geworden. Gelingt es dem Theater, die "ursprüngliche Frische" seiner Werke zurückzugewinnen? Schiller, Schiller, Schiller – wer hält das, ernsthaft gesagt, auf Dauer aus? Manchmal gelingt es, ihn unkonventionell zu inszenieren. Sage also niemand etwas gegen Schiller, nur langweilig mögen seine Stücke nicht aufgeführt werden. Entscheidend sei ja stets, wie Fontane anlässlich einer Inszenierung von "Kabale und Liebe" bemerkt, dass etwas Neues sichtbar werde, ein "Etwas", das von dem Rollenhaften abweiche, und "das Sentimentale, Phrasenhafte, Unwahre kommt in Wegfall und eine Gestalt wird geboren, die Leben und historisches Gepräge hat und vor Allem – uns interessirt". Nicht selten wird die Zuhörerschaft durch "hochfliegende Tiraden" in eine "nicht unerhebliche Langeweile" versetzt. Schillers Dramen lebensnah aufzuführen, ist eine Herausforderung. Wenigen gelingt es, gestern und heute. So merkt Fontane kategorisch an: "Ersichtlich Unfertiges gehört nicht auf die Bühne." Er hat manches davon sehen müssen. Am Gendarmenmarkt also scheiterten zu seiner Zeit Schauspieler, mehr noch Dramaturgen. Das Publikum goutiert manchmal sogar das. Und Schiller zieht an – warum eigentlich? Nicht der Philosophie wegen, von der er erfüllt ist, aber wegen der inwendigen Leidenschaft, die ihn antreibt. Fontane stellt fest: "Das Schiller-Publikum stirbt nicht aus; was von den Alten abfällt, ersetzt sich doppelt durch eine nachwachsende Jugend, an der der große Dichter fast ebenso um seiner schwachen wie um seiner starken Seiten willen nach wie vor seine Zauber übt." Manches Mal bleiben nur gelungene Momente haften, der Auftritt eines Gaststars zum Beispiel. Fontane lobt gerne, besonders gern Frauen. Oft sieht er in all den Jahren "Don Carlos", am 4. April 1883: "In der That, unsere Don Carlos-Aufführungen zählen zu dem Langweiligsten, was man sehen kann, und nach dritthalb Akten floh ich mit dem Eindrucke, wenigstens zehne gesehen zu haben." Auch ein erfahrener Theaterkritiker hält nicht alles aus. Dem Missglückten mögen die besten Absichten vorausgegangen sein, das Beispiel Fontane zeigt uns: Wenn wir etwas zuinnerst nicht oder nicht länger aushalten – warum sollten wir nicht einfach aufstehen und gehen dürfen? Die bürgerliche Etikette vielleicht mag sagen, das gezieme sich nicht. Fontane war es gleich, was andere über ihn dachten. Zugleich sagte er, dass er nicht zu jenen gehöre, "die die Menschheit erst vom Baron an aufwärts zu rechnen beginnen". Auch die "Feudalpyramide" würde er, lebte er anderswo, nicht vermissen, ebenso wenig den moralisierenden, despektierlichen Ton all jener Preußen, die ganz genau zu wissen meinen, was man tun dürfe und was nicht. Fontane forderte nicht dazu auf, schlechte Inszenierungen einfach ungeniert zu verlassen. Er zeigte aber, dass es möglich ist und vielleicht sogar ganz persönlich geboten sein kann.
Zurück zu den Klassikern: Wenn Schillers Dramen nicht gegeben wurden, so wurde Lessing aufgeführt, etwa "Emilia Galotti". Im April 1871 tritt in einer Inszenierung ein Fräulein Faber aus Kassel als Emilia auf. Fontane entschuldigt sich, den Gast nicht loben zu können. Er muss also ehrlich bleiben. Immerhin gesteht er zu: "Die Erscheinung ist anmuthig." Er sieht also eine äußerlich schöne Frau. Ansonsten beobachtet er Mittelmaß. Die Dame sei "hinnehmbar", habe nicht gestört. Dann fährt er fort: "Sie traf unser Herz an keiner Stelle. Und das ist schlimm." Ihr Mienenspiel kritisiert er, insbesondere eine "gewisse flaue, larmoyante Verdrießlichkeit". Sie füllt ihre Rolle unauffällig aus, der Rest ist Routine, kümmerliche Professionalität – und der Kritiker bedauert das sehr. Bei Lessing-Stücken – so auch bei "Nathan der Weise" – ist Fontane oft unzufrieden. Das "Hohelied der Humanitätslehre" werde zuweilen mit dem "Menschheitsapostelton" vorgetragen, "wodurch das Ganze leis salbungsvoll und theatralisch und jedenfalls eines Theils seiner großen und tief innerlichen Wirkung beraubt wurde". Am 12. Oktober 1888 besucht er erneut eine Aufführung von "Emilia Galotti". Fontane wünscht sich Leidenschaft und sieht Professionalität: "Frische Kräfte sind durchaus nöthig; es wird gut gespielt, aber langweilig, weil die Spielenden selber keine rechte Freude mehr an der Sache haben. Und diese Lust bedeutet viel und mitunter alles."
Die Theaterkunst lebt nicht nur von Anmut und Grazie, trotzdem darf Schönheit gelobt werden. Der Kritiker findet Gelegenheiten. An "Der neue Achilles" von Josef Weilen erinnert sich heute wohl kaum noch jemand. Fontane beschreibt ein tendenziöses Stück mit Stereotypen, darunter seien ein "dummer und dicker Diplomat" sowie ein "dünner und diabolischer Jesuit". Er gehöre nicht zu der Minorität, die an die "Dummheit der Diplomaten" und an den "Diabolismus der Jesuiten" glaube. Unter jenen Verschwörungstheoretikern des 19. Jahrhunderts kursierten "Schlagwörter", die einerseits "verbraucht" erscheinen, andererseits zu den "langweiligsten und ödesten" gehören. Trotz überflüssiger Szenen und mancher Längen gefällt dem Theaterkritiker das Stück – aber warum? Es liegt an der Schauspielerin in der Rolle der Königin Christine. Die "römische Convertitin" tritt auf, ohne majestätisch und entrückt zu erscheinen. Sie sei eine "schöne, königliche Frau, die einsam auf ihrer Höhe, sich nach einem Menschen und Heldenherzen sehnt". Manche Schönheit ziehe die Herzen auch mehr empor als ein "halbes Dutzend Schinkelsche Schönheitsbauten". Mit pompöser Architektur weiß er ohnehin wenig zu beginnen. Das "Schönheitsgesetz" zieht Fontane vor, er nennt es – mit Blick auf die "Brunhild" in Geibels gleichnamigem Stück – eine "Colossal-Leistung": "Es ist allerpersönlichst unsere Schwäche, aber auch unsere Stärke, uns um Doktrinen nicht allzuviel zu sorgen und in letzter Instanz den Muth zu einem einfachen Appell an unser Herz zu haben. Unser Herz aber sagt uns: hier lebt eine Kraft, die wir, über alles Kunstgesetz hinaus, ja diesem zum Trotz, in ihrer vollen subjektiven Berechtigung anerkennen müssen."
In all den Jahren sieht Theodor Fontane "unsagbar Langweiliges", immer wieder. Zeitgenössischen Dramatikern mangele es oft an der "hohen Serenität der Seele". Bei Paul Heyse etwa stellt er einen "larmoyanten Ton" und fade "Sentimentalität" fest. Manchmal gebe es auch dumme Witze oder alberne Anekdoten, die eine "krampfhafte Heiterkeit" auslösen. Er erwägt, worin die echte Kunst auf der Bühne im Grunde bestehe: "Die Leidenschaft, falls einer sie hat, spielt sich von selbst; dazu bedarf es nur geringer Kunst. Die Kunst zeigt sich am vollkommensten im Kleinen; das Alltägliche in seiner Alltäglichkeit zu geben und es doch zugleich derselben zu entkleiden, zählt zu ihren ächtesten und schwierigsten Aufgaben. In einem Idyll ist mehr Kunst, als in einem Sensationsroman. Wo der Stoff das Interesse trägt, ist es leicht eine Wirkung zu erzielen. Dasselbe gilt auf der Bühne von der Leidenschaft; ihr fallen die Herzen wie von selber zu. Aber was eigentliche Kunst ist, offenbart sich, in der Mehrzahl der Fälle, erst im Stillen …" Immer wieder Freude hat er an Shakespeare, sofern deutlich werde, "daß das Aelteste das Neueste ist": "Es ist die Aufgabe des Theaters uns zu erheben und zu erheitern, und das Neue soll dabei eine besondere Berücksichtigung finden, wenn es jenen Zwecken dient; das Neue aber, blos als Neues, hat gar keine Berechtigung und kann durch zurückliegendes Bewährtes sehr wohl ersetzt werden. Das Aechte ist immer jung."
In diesen Bänden folgen wir als Leser mehr als zwanzig Jahre hindurch der Berliner Theatergeschichte, die wir mit den Augen Theodor Fontanes uns vergegenwärtigen dürfen. Seine Kritiken bieten uns ein immenses Lesevergnügen. Langweilig ist er nie. Am 6. Februar 1884 äußert Fontane ein nüchternes Liebesbekenntnis: "Je länger man mit dem Theater zu thun hat, je mehr lernt man sich bescheiden und von hochfliegenden, auf das schlechtweg Vollkommene gerichteten Wünschen Abschied zu nehmen. Man lernt rechnen mit dem Gegebenen, mit dem jedesmal Möglichen und läßt es sich gefallen, ohne das Ideal darüber zu vergessen, auf die tagtägliche Verwirklichung desselben zu verzichten." Der Theaterkritiker Theodor Fontane verdient den Applaus seiner Leserschaft.